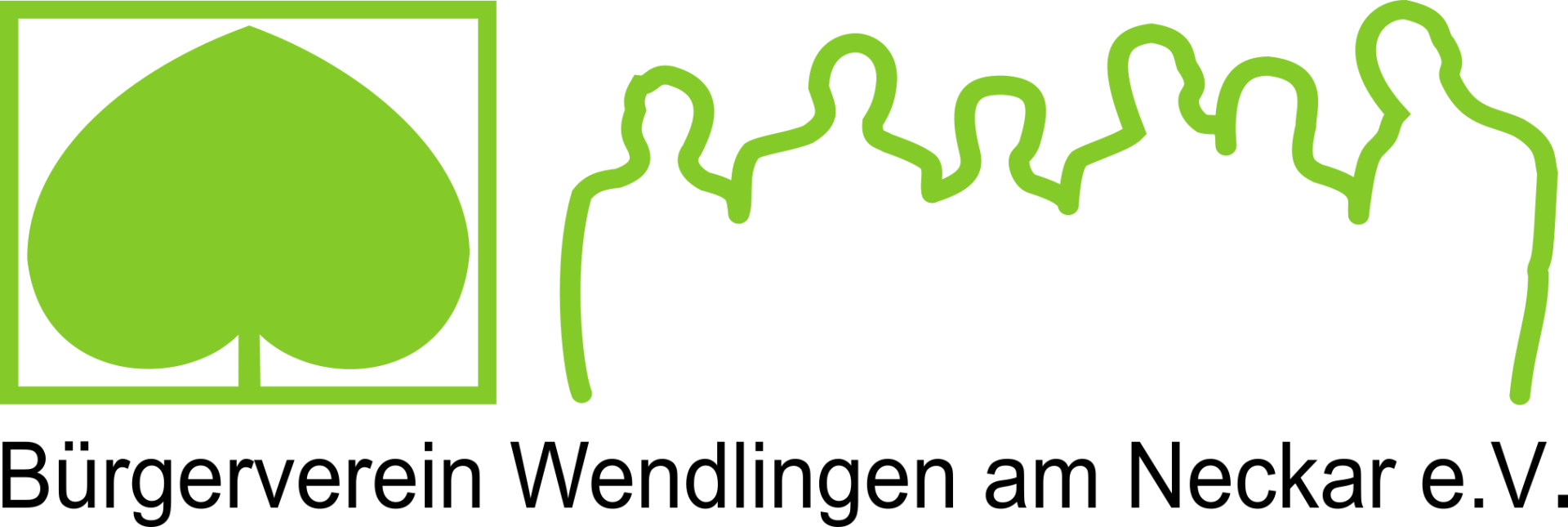Aufnahme von Eugen Ragg vom Ausschließungsschein des Wehrbezirkskommandos 1939
Bild im Staatsarchiv Ludwigsburg (StAL)
Eugen Ragg
* 12.2.1917
† 4.6.1942

Jugend in Wendlingen, Ausbildung und Arbeit
Eugen war das älteste von fünf Kindern des Fabrikarbeiters Eugen Ragg und seiner Frau Sofie. Die Familie zog 1930 aus Oberesslingen nach Wendlingen in die Pfauhauser Straße 6. Die Verhältnisse waren schwierig: Der Vater konnte aufgrund einer Kriegsverletzung zeitweise nicht arbeiten, es gab Streit mit dem Hausbesitzer, und der ältesten Schwester Sofie drohte ein Verfahren zur Sterilisierung. Der junge Eugen Ragg absolvierte wohl eine Schuhmacherlehre, war beim Reichsarbeitsdienst (RAD) und anschließend bei der Firma Ritter in Esslingen als Maschinenarbeiter.
Kriegsbeginn, das „Vergehen“ und die Strafe
Am 11.9.1939 hörte der damals 22-Jährige den französischen Radiosender Straßburg für etwa 5 Minuten so laut, dass es die Frau des Hausbesitzers mitbekam. Sie alarmierte ihren Mann und erstattete am nächsten Tag Anzeige gegen Eugen Ragg. Eine Befragung seiner Arbeitskollegen ergab, dass er die „Greuelnachrichten“ bei der Arbeit weitererzählt hatte. Das Sondergericht Stuttgart verurteilte ihn daraufhin zu 1 Jahr und 1 Monat Haft wegen „Abhörens eines Auslandssenders in Tateinheit mit einem Vergehen gegen das Heimtückegesetz“ und schließt ihn dauerhaft vom Dienst in der Wehrmacht aus. Der Fall wird ausführlich im Teckboten kommentiert.
Haft und Tod im KZ – ein letzter Brief
Eugen Ragg trat die Haft im Oktober 1939 im Zuchthaus Ludwigsburg an, kam dann ins Straflager Aschendorfermoor II, anschließend in die Konzentrationslager Welzheim und Dachau. Auch nachdem er seine offizielle Haftstrafe verbüßt hatte, ließ man ihn nicht frei, sondern verbrachte ihn am 8.4.1941 ins KZ Ravensbrück. Ein Zeuge berichtete, Eugen Ragg bei einer Gruppe von Häftlingen gesehen zu haben, die im März 1942 ins KZ Lublin (Majdanek) überstellt wurden. Laut Sterbeurkunde soll er jedoch am 4.6.1942 in Ravensbrück verstorben sein.
Sein letzter Brief vom 3.2.1942 klang noch hoffnungsvoll: „Doch wird die Zeit auch wiederkommen, wo wir alle beisammen sein werden. Macht Euch also weiter keinen Kummer um mich.“
„Die Presse ist die siebte Großmacht! (…) Wer die Presse hat, hat die öffentliche Meinung. Wer die öffentliche Meinung hat, der hat recht. Wer recht hat, der kommt in den Besitz der Macht.“
Joseph Goebbels, Der Angriff, 30. Januar 1933
In der NS-Zeit unterstanden Presse, Funk, Film und Verlage der Kontrolle durch das „Reichsministerium für Volksaufklärung und Propaganda“, das diktierte, was berichtet werden durfte. Verstöße zogen Berufsverbot, Haft oder Schlimmeres nach sich. „Feindliche“ Medien wie Auslandssender durften nicht genutzt, ihre Inhalte nicht verbreitet werden.
So entstand ein Klima der Angst, in dem Denunziantentum florierte: Bürger meldeten verdächtiges Verhalten oder Äußerungen bei Staatsschutz, Partei oder Gestapo – oft anonym, mit teils schwerwiegenden Folgen für Betroffene. So stützte auch ein Netz gegenseitiger Überwachung die Machterhaltung des NS-Regimes.